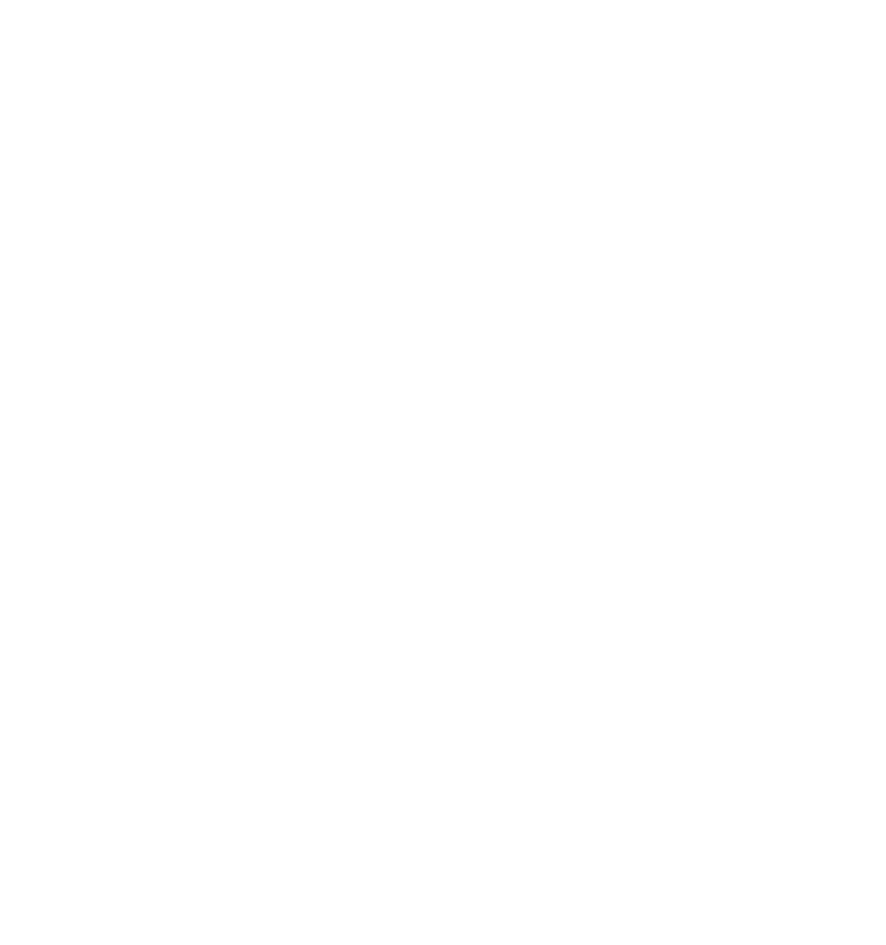Covid Impfaktion für Kurzentschlossene
Wir impfen am
Freitag den 14.01. zwischen 10 und 14 Uhr mit BioNtech.
Ihre Freunde und Familie nehmen Sie gerne mit!
Wichtiger Hinweis: Nehmen Sie bitte Ihren Impfausweis und die Versicherungskarte mit!
Wir möchten mit Ihnen gemeinsam die Pandemie bekämpfen!
Ihr Klinikteam Menterschwaige
Wenn Sie an einer unserer Fortbildungen (zertifiziert mit jeweils 2 Punkten der BLÄK) teilnehmen möchten, bitten wir Sie, sich anzumelden. Die Fortbildung finden jeweils von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt.
Tel.: 089 / 64 27 23 - 0
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie finden in der Klinik Menterschwaige bis auf Weiteres keine externen Fortbildungen statt.
Da es, bedingt durch den Klinikalltag, zu Terminverschiebungen kommen kann, bitten wir Sie, den Termin jeweils zeitnah zu verifizieren. Vielen Dank!
Selbstschädigendes oder autoaggressives Verhalten beschreibt Verhaltensweisen, bei denen sich die betroffenen Menschen absichtlich Verletzungen oder Wunden zufügen.
Ursächlich ist eine Störung des Körperschemas, bei der der eigene Körper nicht als dem Selbst zugehörig erscheint.
Autoaggressives Verhalten kann auch als Selbstbestrafung dienen.
Krank ohne Befund?
Wenn es der Seele schlecht geht, dann geht es auch dem Körper schlecht. Unter psychosomatischen Erkrankungen versteht man körperliche Erkrankungen und Beschwerden, die durch psychische Belastungen oder Faktoren hervorgerufen werden.
Aber auch organische Probleme, die zu psychischen Beschwerden führen, werden als psychosomatische oder somatoforme Störungen bezeichnet.
Eine Krankheit (Parkinson, Krebs, etc.) löst bei vielen Betroffenen Gefühle wie Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit und Angst aus. Das ist mehr als verständlich.
Symptome für psychische Belastung können - außer einer veränderten Stimmungslage - zum Beispiel über längere Zeit anhaltende Schlaflosigkeit, mangelnder Appetit oder fortwährendes Grübeln sein.
Wenn diese Symptome über längere Zeit andauern, dann ist eine psychotherapeutische Begleitung sinnvoll.
Fast die Hälfte der Menschheit erlebt im Laufe eines Lebens ein traumatisches Ereignis, als Zeuge von Unfällen oder Schicksalsschlägen, als Opfer von Folter oder Gewalt. Vielen Menschen gelingt es glücklicherweise, das Erlebte zu verarbeiten.
Den Menschen, die damit Probleme haben und aufgrund des Ereignisses eine psychische Erkrankung ausbilden, bieten wir unsere Unterstützung an. Wir helfen, diese Traumafolgestörungen und möglicherweise daraus resultierte Nebenerkrankungen zu bewältigen.
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist wohl die bekannteste Traumafolgestörung. Sie tritt üblicherweise Tage bis Wochen, manchmal aber auch erst Monate oder Jahre nach einem traumatischen Erlebnis auf. Sie kann alle Bereiche des Erlebens und Verhaltens eines betroffenen Patienten betreffen: Gedanken und Gefühle drehen sich lange Zeit um das Erlebte, belastende Erinnerungen drängen sich auf. Aber auch körperliche Symptome und die Anfälligkeit für körperliche Erkrankungen können in Folge eines traumatischen Ereignisses auftreten: Alpträume, Schreckhaftigkeit, aber auch eine Vermeidung von möglicherweise angstauslösenden Situationen bis hin zum sozialen Rückzug.
Anpassungsstörungen sind Reaktionen auf eindeutig belastende Situationen wie zum Beispiel Beendigung einer Beziehung oder auch bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz.
Unter Anpassungsstörung versteht man einen vorübergehenden Zustand, in dem es der betroffenen Person nicht gelingt, sich mit verschiedenen Belastungssituationen konstruktiv auseinanderzusetzen. In der Folge können sich Ängste und Depressionen ausbilden.
„Ist die Seele krank, kann dies in einem gestörten Essverhalten erkennbar werden“. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass mehr eine halbe Million junger Mädchen und Frauen unter einer Essstörung leiden. Bei 33% der Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren gibt es bereits Hinweise auf eine Essstörung. Essstörungen betreffen aber auch immer mehr junge Männer. Die Altersspanne liegt dabei bei beiden Geschlechtern zwischen 12 und 35 Jahren.
Bei Essstörungen kreisen die Gedanken ständig um das Essen. Die Betroffenen haben ein verzerrtes Selbstbild von sich; sie fühlen sich stark unter Druck gesetzt und versuchen, diesen Druck durch ihr Essverhalten zu kompensieren. Typische Kennzeichen:
Ein gestörtes Körperbild, d.h. des Gefühls für den eigenen Körper, Eine Störung der Wahrnehmung körpereigener Vorgänge und der Wahrnehmung von Gefühlen sowie ein alles durchdringendes Gefühl eigener Unzulänglichkeit.
Psychiatrische Störungen meinen psychische Störungen, die in verschiedenen Krankheitsbildern auftreten.
Affektive Störungen sind Stimmungsstörungen, die sich durch Zustände gedrückter und gehobener Gefühlslage – also Depressionen und Manien – bemerkbar machen. Wechseln sich manische und depressive Phasen ab, besteht eine bipolare affektive Störung (früher: manisch-depressive Erkrankung).
Die Zwangsstörung (Zwangserkrankung) ist eine häufige psychische Störung. Die Betroffenen spüren immer wieder den Zwang, bestimmte Handlungen auszuführen oder leiden an aufdringlichen Gedanken. Unterschieden werden dabei Zwangshandlungen, Zwangsgedanken oder Zwangsimpulse. Sie werden von den Patienten selbst als belastend und unsinnig empfunden, können aber nicht unterdrückt werden, auch wenn Widerstand gegen sie geleistet wird.
Als Psychose versteht man in vielen Fällen vorübergehende psychische Störungen, bei denen die Betroffenen die Realität verändert wahrnehmen oder verarbeiten. Das Krankheitsbild bei Psychosen ist sehr vielfältig und beschreibt Halluzinationen oder Wahnvorstellungen bis hin zu Denkstörungen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert eine Persönlichkeitsstörung als ein tief verwurzeltes Verhaltensmuster, das sich in starren Reaktionen auf verschiedene Lebenslagen äußert. Als „starre Reaktion“ wird definiert, dass ein betroffener Patient mit einer Persönlichkeitsstörung in seinem Verhalten wenig flexibel ist und auch aus der Erfahrung heraus das Verhalten nicht korrigieren kann.
Seit der Kindheit oder frühen Jugend besteht das unflexible oder „fehlangepasste“ Verhaltensmuster, die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung wird üblicherweise erst mit der Volljährigkeit der betroffenen Person gestellt. Die am besten geeignete Behandlungsform für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen ist die Psychotherapie.
Beispiele für Persönlichkeitsstörungen:
Borderline Persönlichkeitsstörung:
Im Vordergrund stehen Stimmungsschwankungen, Betroffenen leben meist intensive aber instabile Beziehungen, sie berichten von einem Gefühl von Leere, Suizidalität, und leben häufig mit der Angst verlassen zu werden.
Antiosoziale Persönlichkeitsstörung:
Betroffene zeigen ein impulsives, aggressives Verhalten bei mangelndem Schuldbewusstsein.